Signatur: BStU, MfS, HA IX, Tb, Nr. 212-219
Am 23. September 1955 fand vor dem Obersten Gericht der DDR in Berlin ein Geheimprozess gegen Elli Barczatis und Karl Laurenz wegen Spionage für die Organisation Gehlen statt. Er war einer von mehreren Prozessen gegen tatsächliche oder vermeintliche Agentinnen und Agenten des westdeutschen Nachrichtendienstes in den 50er Jahren. Am Ende des Prozesses wandte sich Laurenz in seinem Schlusswort noch einmal an das Gericht.
Elli Barczatis wurde Anfang der 50er Jahre vermutlich ohne ihr Wissen zur Informantin für die Organisation Gehlen, die Vorläuferin des Bundesnachrichtendienstes (BND). Der westdeutsche Geheimdienst nutzte sie als Quelle in Ost-Berlin, ohne sie offiziell in diese Tätigkeit einzuweihen. Von April 1950 bis Januar 1953 war Barczatis die Chefsekretärin des Ministerpräsidenten der DDR, Otto Grotewohl. Kurz zuvor ging sie eine Liebesbeziehung mit dem Journalisten und Übersetzer Karl Laurenz ein, der nach seinem Bruch mit der SED und den daraus resultierenden beruflichen Schwierigkeiten begonnen hatte, für die Organisation Gehlen zu spionieren. Unter dem Vorwand, Material für seine journalistische Arbeit zu sammeln, ließ er sich von Barczatis mit internen Informationen aus dem Büro des Ministerpräsidenten versorgen.
Anfang 1951 wurde das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) durch den Tipp einer ehemaligen Kollegin von Barczatis, die später als Geheimer Informator (GI) für das MfS arbeitete, auf die beiden aufmerksam. Nach ersten Ermittlungen eröffnete die Stasi am 26. Juni 1951 wegen Spionageverdachts den Gruppenvorgang "Sylvester" gegen Barczatis und Laurenz. Dieser Schritt erfolgte, wenn sich ein Verdacht gegen mehrere Personen wegen "feindlicher Tätigkeit" erhärtete. In der Folgezeit unternahm die Stasi in enger Zusammenarbeit mit der sowjetischen Geheimpolizei weitere Schritte gegen Barczatis und Laurenz. Dazu gehörten Observierungen, Telefonüberwachungen und Briefkontrollen. Im Januar 1953 wurde Barczatis zu einem Parteilehrgang nach Potsdam delegiert. Danach erhielt sie zwar wieder eine Anstellung im Amt des Ministerpräsidenten, jedoch nicht mehr als persönliche Sekretärin Grotewohls, sondern in der Eingabenbearbeitung. Vermutlich veranlasste das MfS diese Versetzung, da es bereits seit 1953 von der Weitergabe interner Informationen aus dem Büro des Ministerpräsidenten an die Organisation Gehlen durch Barczatis bzw. Laurenz wusste. Am 4. März 1955 wurden die beiden verhaftet. Die Festnahme fiel in die Endphase der "Konzentrierten Schläge", die die Stasi im Nachgang des Aufstandes vom 17. Juni 1953 durchgeführt hatte. Diese Aktion symbolisierte einen Strategiewechsel des MfS bei der Verfolgung tatsächlicher oder vermeintlicher Agentinnen und Agenten westlicher Geheimdienste, insbesondere der Organisation Gehlen.
Am 23. September 1955 kam es vor dem 1. Strafsenat des Obersten Gerichts der DDR in Berlin-Mitte zum Prozess wegen Spionagetätigkeit. Generalstaatsanwalt Ernst Melsheimer war für die Anklage zuständig, nahm aber nicht am Prozess selbst teil. Obwohl Barczatis spätestens mit dem Ende ihrer Tätigkeit für Grotewohl Anfang 1953 nur noch wenige nachrichtendienstlich verwertbare Berichte an Laurenz lieferte, verurteilte das Gericht beide Angeklagten zum Tode. Am 23. November 1955 wurden sie in der Untersuchungshaftanstalt I in Dresden durch das Fallbeil hingerichtet.
Von fast fünfzehn Stunden Verhandlung sind circa fünf als Tonbandaufnahmen im Archiv des BStU überliefert. Beim vorliegenden Ausschnitt handelt es sich um das Schlusswort von Karl Laurenz nach dem Plädoyer des Staatsanwalts.
Der Angeklagte legt dem Gericht noch einmal die Gründe für seine Zusammenarbeit mit der Organisation Gehlen dar. Seine Kritik an der SED spricht er dabei offen an, betont aber gleichzeitig seine Verbundenheit zur DDR. Am Ende appelliert er, wie zuvor schon Barczatis, an das Gericht, Milde walten zu lassen und die Todes- in eine Haftstrafe umzuwandeln.
Trotz der ursprünglichen Empfehlung Melsheimers zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe, bestätigte das Oberste Gericht das Todesurteil. Nach der Ablehnung eines Gnadengesuchs durch den Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, wurde es in den frühen Morgenstunden des 23. November 1955 vollstreckt. 2006 rehabilitierte das Landgericht Berlin Elli Barczatis und Karl Laurenz nach einem Antrag des Mauermuseums am Checkpoint Charlie.
[Richter Ziegler:]
Angeklagter Laurenz, treten Sie vor.
[Schritte]
[Karl Laurenz:]
[räuspert] Hoher Senat. [atmet schwer]
Ich bin mit 46 Jahren zum ersten Mal mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten, mit 50 Jahren zum zweiten Mal. Beide Male in meiner zweiten Heimat.
Das erste Mal war, wie ich schon vorhin mal sagte, in der Hauptsache meine österreichische Gutmütigkeit daran Schuld. Ich komme mal aus einem anderen Volk und habe eine andere Wesensart.
Das zweite Mal war es meine Michael-Kohlhaas-Natur, die sich gegen das Unrecht auflehnen zu müssen glaubte, das ich in der Tatsache erblickte, dass man mir, der ich seit frühester Jugend ununterbrochen intensiv gearbeitet habe, und dem die Arbeit zum Lebensbedürfnis geworden ist, plötzlich im besten Mannesalter und bei vollster geistiger Schaffenskraft jede Arbeitsmöglichkeit nahm. Ich habe den lieben Herrgott in meinem frühen Leben oft gebeten mir einmal [betont: eine] Stunde zu schenken, in der ich vor Langeweile nicht wüsste was ich anfangen soll. Damals hat er mir die Erfüllung dieser Bitte versagt. In den letzten Jahren hat er mir solche Stunden zum Überdruss viele gegeben. Ich habe darin eine sinnlose Vernichtung meiner Existenz gesehen. Man kann dem widersprechen, der Herr Staatsanwalt hat es getan, und kann mir zu bedenken gegeben, dass ich bestimmt Arbeit gefunden hätte, wenn ich mich zum Beispiel als Ziegelputzer gemeldet hätte.
Dazu möchte ich sagen, wenn ich nach dem Zusammenbruch gerne zweieinhalb Jahre als Weichensteller gearbeitet habe, also als Bergarbeiter. So konnte ich damals, die dafür in ganz Deutschland herrschende Debellatio, das heißt den Zustand totaler zerrissen, Zerfahrenheit, verantwortlich machen.
Heute, da wir in einem Rechtsstaat leben, der durch Verfassung und besonderes Gesetz [betont: jedem] seiner Bürger das Recht auf Arbeit gewährleistet, sogar auf angemessene Arbeit. Hätte ich mich fragen können, wozu ich eigentlich 20 Jahre lang studiert habe und mich bis zum 40. Lebensjahr ehrlich geschunden habe, wenn ich meiner zweiten Heimat nicht anders dienen kann, denn als Ziegelputzer. Ich hätte mich fragen können wo denn der Sinn einer solchen Sinnlosigkeit liegen soll. Ich habe mir solche Fragen [betont: nicht] vorgelegt, sondern ich habe Bewerbungen geschrieben, wobei 90 Prozent meiner Bewerbungen sich auf untergeordnete Arbeiten richteten. Ich habe mich als BVG-Schaffner beworben, ich habe mich als Abrissarbeiter beworben, bei der Abbruchfirma Schmidt in der Greifswalder Straße, alles zwecklos.
Ich habe für diese Existenzvernichtung, wie ich meinte mit Recht, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands verantwortlich gemacht und bin ihr gegenüber in Opposition gegangen. Ich habe das [betont: nicht] bereut, denn schließlich hielt ich die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands für eine Kampfpartei und eine Kampfpartei muss mit Opposition rechnen. Was ich aber zutiefst bereute und bereue natürlich, ist die von mir nicht in Rechnung gestellte Tatsache, dass ich mich mit meiner Opposition gegen die Sozialistische Einheitspartei bei der engen Verquickung, die zwischen gerade dieser Partei und der Deutschen Demokratischen Republik besteht, naturnotwendig auch in Opposition gegen die Deutschen Demokratische Republik stellen musste.
Ich empfinde es als persönlich tragischen Konflikt, dass ich mir durch meine unentschuldbaren Verbrechen selbst den Stempel aufgedrückt habe, ein Feind des Staates zu sein, den ich als meine zweite Heimat trotz mancher bitterer Erfahrung doch lieben gelernt habe. Ich emfinde es auch deshalb als tragischen Konflikt, weil ich mich absolut frei weiß von jedem Gefühl irgendeiner Feindschaft oder irgendeines Hasses, wie denn diese beiden Gefühlswerte in meiner religiös abgestimmten Gefühlsskala gar nicht vorhanden sind. Mein Verbrechen, so schändlich es auch war, entspringt weder irgendeinem Hass noch irgendeiner Feindschaft, sondern [betont: ausschließlich] meiner Arbeitslosigkeit, die ich trotz gezählter hundert Bewerbungen [betont: nicht] beheben konnte. Hätte mich mein Schicksal, das mich bis zum Jahre 1950 - also bis zu meinem 45. Lebensjahr - nicht einen einzigen Tag arbeitslos sein ließ, auch in den folgenden Jahren mit diesem Übel verschont, dann, hohes Gericht, brauchte ich mich heute nicht vor Ihnen verantworten. Denn ich bitte Sie mir zu glauben. Ich bin kein geborener Verbrecher und auch in mir hat einmal das heilige Feuer des Rechts geglüht.
Ich hatte in den letzten sieben Monaten reichlich Gelegenheit die Irrungen meines Lebensweg in den letzten Jahren zu überdenken und zu überprüfen. Es ist mir nach ziemlich schwerem Kampf gelungen, den inneren Schweinehund, der seit '52 von mir Besitz ergriffen hatte, zu überwinden und auf den rechten Weg zu finden. Das ist keine Erfindung der letzten fünf Minuten, sondern darüber sprach ich schon mit meinem Vernehmer vor zwei Monaten. Ich habe diese für mich immerhin wichtige Tatsache in einem Vers'chen festgehalten, das da lautet:
Ich komme aus Nacht und Finsternis,
sie sollen mich nicht mehr begleiten.
Ein dunkler Vorhang plötzlich zerriss -
ich will dem Lichte entgegen schreiten.
Ich habe dabei allerdings nicht an die lux perpetua gedacht, in deren gefährliche Nähe mich der Antrag des Herrn Staatsanwalts heute bringt.
Hoher Senat, ich habe meine Dissertation geschrieben unter den Titel "De poena capitalis mutandis in temporibus" - "Über die Todesstrafe im Wandel der Zeiten". Es ist ein Witz meines Schicksals, dass ich heute hören musste, dass die Todesstrafe gegen mich beurt- - äh - beantragt wurde. Vor zehn Jahren hat mir ein Bürgermeister in Profen mal gesagt: "Sie sind nicht unser Gast, sie sind uns zur Last." An diesem Ausspruch habe ich mich bei dem Antrag des Herrn Staatsanwalts erinnert gefühlt und ich bitte um Entschuldigung, wenn ich falsch gehört habe, beziehungsweise mein Inneres falsch gehört hat. Ich dachte mir: na ja, also du bist ja hier nicht der Gast sondern zu lasten, wirst eben liquidiert, ne.
Mein Leben war nicht leicht, es war arbeitsreich. Meine Familie ist zerrissen, meine Kinder da, meine Frau da und so weiter. Das sind alles persönliche Dinge, die ich nicht - mit denen ich das, den hohen Senat nicht belasten will.
Ich weiß, dass ich sehr schwere Schuld auf mich geladen habe, gegen meine zweite Heimat. Ich weiß, dass ich dafür auch schwer bestraft werden muss. Aber trotzdem bitte ich den Hohen Senat den erschütternden Antrag des Herrn Staatsanwalts [betont: nicht] zu folgen und es unter Anwendung des, der Rechtssprechung der Deutschen Demokratischen Republik auszeichnenden Prinzips der tiefsten Menschlichkeit bei einer langjährigen Freiheitsstrafe verwenden zu lassen. Ich will [betont: in härtester Arbeit] wiedergutmachen. Ich will mich nicht schonen. Auch von mir kann man noch irgendetwas für den Aufbau erreichen. Natürlich im Rahmen des Strafvollzugs. Von dem toten Laurenz hat niemand etwas.
Ich bitte Sie sehr, ich sage es ganz offen, Gnade vor Recht geben, walten zu lassen.
[Richter Ziegler:]
Das ist das, was Sie als Verteidigung und als Schlusswort zu sagen hatten?
[Karl Laurenz:]
Jawohl, Herr.
[Richter Ziegler:]
Treten Sie zurück, Angeklagter.
Von Seiten des Staatsanwalts zur Erwiderung das Wort jewünscht [gewünscht]?
[Staatsanwalt Lindner:]
Ich verzichte auf Erwiderung.
[Scharren eines Stuhls]
[Richter Ziegler:]
Dann wird der Senat beraten.
[Anwesende erheben sich, Schritte]
Haft im MfS
Die in der DDR herrschende diffuse Furcht vor dem Staatssicherheitsdienst hatte verschiedene Gründe. Die Angst, einfach abgeholt werden zu können und dann für unbestimmte Zeit zu verschwinden, spielte dabei eine nicht geringe Rolle. Reale Grundlage für diese Angst war das zwar geheime, aber zumindest durch Gerüchte und Vermutungen sehr präsente Haftsystem des MfS.
Schwerpunkt dieses Haftsystems waren 15 Untersuchungshaftanstalten (UHA) auf der Ebene der MfS-Bezirksverwaltungen. Außerdem gab es noch zwei UHA auf Ministeriumsebene in Ostberlin: in der Genslerstraße in Hohenschönhausen (UHA I) und in der Magdalenenstraße in Lichtenberg (UHA II). Das bekannteste MfS-Gefängnis war jedoch die Strafvollzugsanstalt Bautzen II, ein altes Gerichtsgefängnis in Bautzens Innenstadt. Formal betrachtet, unterstand dieses häufig als MfS-Sonderhaftanstalt bezeichnete Gefängnis jedoch der Verwaltung Strafvollzug des DDR-Innenministeriums (MdI); faktisch entschied hier jedoch das MfS über alle wichtigen Fragen, von der Auswahl der Angestellten bis zur Einweisung der Häftlinge.
Das größte MfS-Gefängnis war gleichzeitig das unbekannteste: In Berlin-Hohenschönhausen befand sich unmittelbar neben der Untersuchungshaftanstalt das sog. Lager X, ein Haftarbeitslager für bis zu 900 männliche Strafgefangene. Es existierte von Anfang der 50er bis Mitte der 70er Jahre. Weiterhin gab es in allen Untersuchungshaftanstalten des MfS eigene Strafgefangenenarbeitskommandos (SGAK).
Es gilt also zu unterscheiden zwischen Untersuchungshaft und Strafvollzug. Nur ein kleiner Teil der MfS-Untersuchungshäftlinge kam nach einer rechtskräftigen Verurteilung auch in den Strafvollzug des MfS. In Bautzen II wurden bekannte politische Häftlinge untergebracht, aber auch Gefangene, die wegen schwerwiegender Spionagevorwürfe verurteilt worden waren. Ins Lager X und in die SGAK der Untersuchungshaftanstalten wurden nur verhältnismäßig wenige politische Gefangene überstellt; hier wurden die Gefangenen vor allem für die Verrichtung von Arbeiten für das MfS eingesetzt und daher auch unter dem Gesichtspunkt beruflicher Qualifikation ausgewählt.
Dennoch wurden diese beiden Möglichkeiten wegen der - im Vergleich zum normalen Strafvollzug - besseren Haftbedingungen auch als Belohnung für besonders kooperative Häftlinge genutzt, gleichermaßen wegen der besonderen Geheimhaltung, aber auch zur Isolierung von straffällig gewordenen MfS-Mitarbeitern oder Funktionären aus Politik und Wirtschaft.
Das Hauptinteresse des MfS richtete sich auf die Untersuchungshaft. Hier führte das MfS in eigener Zuständigkeit strafprozessuale Ermittlungsverfahren durch und brachte die Beschuldigten in den eigenen Untersuchungshaftanstalten unter. Parallel zur normalen Untersuchungshaft, für die in der DDR seit 1952 nicht mehr die Justizverwaltung, sondern die Verwaltung Strafvollzug des MdI zuständig war, existierte hier ein paralleles Haftsystem für Beschuldigte, die vom MfS als Feinde eingestuft worden waren. Das gesonderte System umfasste nicht nur die Haftanstalten und die für die Ermittlungen zuständigen MfS-Mitarbeiter, sondern es erstreckte sich auch auf die Staatsanwaltschaften und Gerichte.
Für die Aufsicht in den vom MfS geführten Ermittlungsverfahren waren allein Staatsanwälte der Abteilungen I bzw. I A der General- bzw. Bezirksstaatsanwaltschaften zuständig, die vom MfS "bestätigt" worden waren. Das Gleiche galt für die für MfS-Fälle zuständigen Haftrichter. Formal wurden die Anforderungen der Strafprozessordnung zwar gewahrt, faktisch war jedoch das dort normierte System der Unterordnung der Ermittler unter die Staatsanwaltschaft sowie die Unabhängigkeit der Gerichte auf den Kopf gestellt (Justiz, Verhältnis des MfS zur).
Die Zuständigkeit für den Vollzug der Untersuchungshaft und den Strafvollzug lag im MfS bei der Abteilung XIV des Ministeriums sowie den ihr nachgeordneten Abteilungen XIV der Bezirksverwaltungen (Linie XIV). Für die Durchführung des Ermittlungsverfahrens waren die Hauptabteilung IX des Ministeriums sowie die ihr nachgeordneten Abteilungen IX der Bezirksverwaltungen (Linie IX), die im Außenkontakt als MfS-Untersuchungsabteilung firmierten, zuständig. Die Linien IX und XIV lagen im unmittelbaren Anleitungsbereich des Ministers für Staatssicherheit.
Die Haftbedingungen wandelten sich im Laufe der Zeit. Herrschten in den frühen 50er Jahren sehr einfache, an sowjetischen Verhältnissen orientierte, mitunter brutale Unterbringungs- und Umgangsformen vor - erinnert sei hier an das Kellergefängnis in Berlin-Hohenschönhausen, das sog. U-Boot -, besserten sich die materiellen Bedingungen danach langsam, aber kontinuierlich.
Von Häftlingen, die sowohl MfS- als auch MdI-Untersuchungshaftanstalten kennengelernt haben, werden die materiellen Unterbringungsbedingungen, also Zellenausstattung, Hygiene, Verpflegung etc. beim MfS regelmäßig als deutlich besser bezeichnet; innerhalb des MfS gab es ein Gefälle von der Ministeriumsebene zu den UHA der Bezirksverwaltungen. Umgekehrt wurden jedoch die Umgangsregeln beim MfS als unmenschlicher als beim MdI bezeichnet.
Beim MfS galt ein absolutes Primat der Sicherheit: Häftlinge wurden strikt voneinander getrennt; zwar gab es nicht nur Einzelhaft, aber es kam zu keinen zufälligen Begegnungen von Häftlingen untereinander. Sämtliche Kontakte wurden von der Untersuchungsabteilung gesteuert.
Die Häftlinge wurden außerhalb der Vernehmungen nicht mehr mit ihrem Namen, sondern nur mit einer Nummer angesprochen. MfS-Mitarbeitern war jede Kommunikation mit Häftlingen, die über das unbedingt dienstlich Erforderliche hinausging, streng verboten - schließlich hätten so Informationen vom MfS an die als Feinde betrachteten Häftlinge abfließen können. Alle eigentlich normalen Rechte von Inhaftierten, wie Besuchs-, Schreib-, Lese- oder Einkaufserlaubnis, Freigang, Versorgung mit Zigaretten, Kaffee oder Ähnliches, wurden als besondere Belohnung behandelt und von den Vernehmungsoffizieren zur gezielten Steuerung der Aussagebereitschaft eingesetzt.
Häftlinge fühlten sich so meist sehr schnell einem übermächtigen, weder durchschau- noch berechenbaren Apparat ohnmächtig ausgeliefert. Spezielle Methoden, wie die konspirative und überraschende Festnahme, die Einlieferung in geschlossenen Fahrzeugen, die Vermeidung jeglichen Sichtkontakts zu Orientierungspunkten außerhalb des Gefängnisses, die Wegnahme von Uhren und das Verbot von Schreibzeug und Aufzeichnungen in den Zellen, führten bei den Häftlingen oft zu einem Gefühl der räumlichen und zeitlichen Desorientierung.
Hinzu kam ein ausgeklügeltes Spitzelsystem unter den Häftlingen. Die Untersuchungsabteilungen sammelten gezielt Informationen unter den Häftlingen mit Hilfe angeworbener Zuträger, die zunächst als Kammeragenten (KA), später als Zelleninformatoren (ZI) bezeichnet wurden. Sie sollten von ihren Mithäftlingen jene Informationen erlangen, die diese in den Vernehmungen nicht preisgegeben hatten. Insbesondere in den 70er und 80er Jahren sollten sie Häftlinge oft aber auch nur in Gespräche zu bestimmten Themen oder Zusammenhängen verwickeln, die dann von der Untersuchungsabteilung mittels versteckter Abhöreinrichtungen in den Zellen aufgezeichnet und ausgewertet wurden.
Bei den Häftlingen führten diese Bedingungen häufig zu einem Gefühl psychischer Einkreisung, des Ausgeliefertseins und dem Schwinden jeglichen Widerstandsgeistes. Ohnehin hatten die meisten Häftlinge das berechtigte Empfinden einer extrem ungerechten Behandlung. Schließlich war seit Anfang der 60er Jahre die überwiegende Zahl Gefangener lediglich wegen ihrer Bestrebungen, die DDR in Richtung Westen zu verlassen, inhaftiert worden. Sie fühlten sich in ihrem Handeln im Einklang mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und diversen auch von der DDR unterzeichneten völkerrechtlichen Abkommen.
Eine weitere Häftlingsgruppe bildeten Menschen, die durch unerschrockene Wahrnehmung von oder Forderung nach politischen Rechten in den Augen der herrschenden Partei zu einer Gefahr für das Ansehen oder die Existenz der DDR geworden waren. Nur einem sehr kleinen Teil der Häftlinge wurden tatsächliche Staatsverbrechen zur Last gelegt.
Außerdem gab es neben den politischen Gefangenen auch noch Beschuldigte, denen gewöhnliche unpolitische Delikte angelastet wurden, die aber unter besonderer Geheimhaltung ermittelt und verhandelt werden sollten. Eine Rechtsgrundlage für den Betrieb von Untersuchungshaftanstalten durch das MfS gab es nicht. Der Strafvollzug des MfS widersprach seit Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes 1968 ausdrücklich der geltenden Rechtslage. Die strafprozessuale Ermittlungstätigkeit des MfS war erst seit 1968 in der Strafprozessordnung explizit geregelt, fand aber auch vorher statt.
Eine besondere Bedeutung hatten die MfS-Haftanstalten auch für die Praxis des Häftlingsfreikaufs durch die Bundesrepublik. Seitens der DDR wurden die konkreten Freikaufaktionen vom MfS koordiniert und durchgeführt. Sämtliche freigekauften Häftlinge durchliefen kurz vor ihrer Entlassung in die Bundesrepublik daher noch die MfS-Untersuchungshaftanstalt Karl-Marx-Stadt, in der die letzten Formalitäten erledigt wurden und von wo aus die Busse in die Bundesrepublik abfuhren.
Bekämpfung von Widerstand und Opposition umschreibt, was zwischen 1950 und 1989 als eine Kernaufgabe des MfS galt. Gegen den Willen eines Großteils der ostdeutschen Bevölkerung wurde eine Diktatur etabliert, die nicht durch Wahlen legitimiert war: Dies war einer der Gründe für die Bildung des MfS am 8.2.1950.
Um ihren gesellschaftlichen Alleinvertretungs- und Herrschaftsanspruch zu sichern, schuf sich die SED als Repressions- und polizeistaatliche Unterdrückungsinstanz das MfS - das konsequenterweise so auch offiziell von ihr als "Schild und Schwert der Partei" bezeichnet wurde. Bereits in der "Richtlinie über die Erfassung von Personen, die eine feindliche Tätigkeit durchführen und von den Organen des MfS der DDR festgestellt wurden" vom 20.9.1950 wurde dementsprechend festgelegt, dass "alle Personen" zu registrieren seien, deren Verhalten geeignet war, die "Grundlagen" der DDR in Frage zu stellen.
Ferner wurde bestimmt, dass "über Personen, die eine feindliche Tätigkeit ausüben, [...] Vorgänge" anzulegen sind und über "die erfassten Personen [...] eine zentrale Kartei" einzurichten ist. Das offensive Vorgehen gegen Regimegegner erfuhr eine Ergänzung in den gleichzeitig getroffenen Festlegungen zur Übergabe der als "feindlich" klassifizierten Personen an die Staatsanwaltschaften.
Das MfS wurde somit bei der Bekämpfung von Widerstand und Opposition zur Ermittlungsinstanz; die nachfolgenden Urteile gegen Oppositionelle und Regimekritiker ergingen in enger Kooperation mit den vom MfS zumeist vorab instruierten Gerichten und zum Schein vermeintlicher Rechtsstaatlichkeit unter Hinzuziehung von mit dem MfS häufig zusammenarbeitenden Rechtsanwälten.
Inhalte, Auftreten und Erscheinungsbild von politisch abweichendem Verhalten, Widerstand und Opposition wandelten sich im Laufe der DDR-Geschichte. Zugleich änderten sich auch die Strategien und Methoden des MfS in Abhängigkeit vom konkreten Erscheinungsbild von Protest und Widerstand, aber auch analog zum Ausbauniveau des Apparates und seines Zuträger- und Informantennetzes sowie zur jeweils getroffenen Lageeinschätzung und unter Berücksichtigung der politischen Rahmenbedingungen.
Zu allen Zeiten gab es in beinahe allen Bevölkerungsgruppen und in allen Regionen Aufbegehren, Opposition und Widerstand. In den ersten Jahren nach Gründung der DDR gingen die SED und das MfS mit drakonischen Abschreckungsstrafen (u. a. Todesurteilen) gegen politische Gegner vor. Gefällt wurden die Urteile nicht selten in penibel vorbereiteten Strafprozessen mit präparierten Belastungszeugen und unter Verwendung erzwungener Geständnisse.
In mehreren Orten der DDR wurden z. B. Oberschüler (Werdau, Leipzig, Werder, Eisenfeld, Fürstenberg/Oder, Güstrow), die anknüpfend an das Vorbild der Gruppe "Weiße Rose" in der NS-Diktatur Widerstand geleistet hatte, zum Tode oder zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt, weil sie Informationen gesammelt und Flugblätter verteilt hatten. Manch einer von ihnen überlebte die Haftbedingungen nicht oder nur mit dauerhaften gesundheitlichen Schäden.
Im Laufe der 50er Jahre ging das MfS schrittweise zum verdeckten Terror über. Nach wie vor ergingen langjährige Zuchthausstrafen; politische Opponenten, die von Westberlin aus die Verhältnisse in der DDR kritisierten, wurden - wie Karl Wilhelm Fricke 1955 - in geheimen Operationen entführt, nach Ostberlin verschleppt, in MfS-Haft festgehalten und vor DDR-Gerichte gestellt (Entführung).
Das Bestreben der SED, sich in der westlichen Öffentlichkeit aufgrund dieser ungelösten Fälle und angesichts eklatanter Menschenrechtsverletzungen nicht fortlaufender Kritik ausgesetzt zu sehen, führte, begünstigt durch die Absicht, der maroden Finanz- und Wirtschaftslage mit westlicher Unterstützung beizukommen, schrittweise zu einem Wandel. Im Ergebnis kam es auch zu einer Modifikation der MfS-Strategien im Vorgehen gegenüber Widerstand und Opposition.
Neben die im Vergleich zu den 50er Jahren zwar niedrigeren, für die Betroffenen aber nach wie vor empfindlich hohen Haftstrafen traten als beabsichtigt "lautloses" Vorgehen die Strategien der Kriminalisierung und Zersetzung. In einem "Entwurf der Sektion politisch-operative Spezialdisziplin" des MfS, der auf 1978 zu datieren ist, wird hierzu ausgeführt: "Um der Behauptung des Gegners die Spitze zu nehmen, dass wir ideologische Meinungsverschiedenheiten oder Andersdenkende mit Mitteln des sogenannten politischen Strafrechts bekämpfen, sind dazu noch wirksamer Maßnahmen zur Kriminalisierung dieser Handlungen sowie nicht strafrechtliche Mittel anzuwenden."
In der Richtlinie 1/76 "zur Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge" vom Januar 1976 wurden unter Punkt 2.6 "die Anwendung von Maßnahmen der Zersetzung" geregelt und unter Punkt 2.6.2 die "Formen, Mittel und Methoden der Zersetzung" erörtert. Jene reichten u. a. von der "systematischen Diskreditierung des öffentlichen Rufes" auch mittels "unwahrer […] Angaben" und der "Verbreitung von Gerüchten" über das "Erzeugen von Misstrauen", dem "Vorladen von Personen zu staatlichen Dienststellen" bis zur "Verwendung anonymer oder pseudonymer Briefe, […] Telefonanrufe".
Mit der "Ordnungswidrigkeitenverordnung" (OWVO) von 1984 ging man zudem verstärkt dazu über, politisch unliebsame Personen, sofern sie sich an Protesten beteiligten, mit Ordnungsstrafen zu überziehen und sie somit materiell unter Druck zu setzen. All diese Maßnahmen sollten nach außen hin den Eindruck erwecken, dass das MfS weniger rigoros als in früheren Jahren gegen Regimegegner vorging.
Nach der Freilassung von Oppositionellen, die kurz zuvor während der Durchsuchung der Umweltbibliothek 1987 und nach den Protesten am Rande der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration 1988 in Berlin inhaftiert worden waren, äußerten selbst SED-Mitglieder Zweifel, ob das MfS noch in der Lage sei, offensiv und effektiv gegen politische Opponenten vorzugehen.
Hochgerüstet und allemal zum Einschreiten bereit, trat das MfS jedoch noch bis in den Herbst 1989 gegenüber weniger prominenten Menschen in Aktion, die Widerstand leisteten, inhaftierte diese und ließ gegen sie hohe Haftstrafen verhängen. Bis zum Ende der DDR schritt das MfS bei sog. Demonstrativhandlungen ein und ging gegen - wie es hieß - ungesetzliche Gruppenbildungen vor.
Von 1950 bis 1968 geltende Bezeichnung für die gewöhnlichen inoffiziellen Mitarbeiter, in den ersten Jahren auch nur Informatoren genannt. 1968 wurden die GI überwiegend zu IMS. GI dienten vor allem der allgemeinen Informationsbeschaffung. Sie wurden dabei auch zunehmend zur Sicherung von Institutionen, zur Feststellung der Bevölkerungsstimmung, zur Überprüfung verdächtiger Personen, zur Verhinderung von Republikfluchten oder auch bei Ermittlungen und Fahndungen eingesetzt.
In den Untersuchungsorganen des MfS (HA IX und Abt. IX der BV) tätige hauptamtliche Mitarbeiter, die – eingebunden in ihr jeweiliges Referat – strafrechtliche Ermittlungsverfahren weitgehend eigenverantwortlich durchführten, von den Häftlingen meist als Vernehmer bezeichnet. In den 50er Jahren oft nur in internen Kurzlehrgängen ausgebildet, später Diplom-Juristen oder Diplom-Kriminalisten der Juristischen Hochschule des MfS, seltener Universitätsstudium oder VP-Hochschule.
Die Untersuchungsführer galten MfS-intern neben den Mitarbeitern der HV A als Elite. Ihnen oblagen die Vernehmungen von Untersuchungsgefangenen, die Führung der Untersuchungsakten (Untersuchungsvorgang), die Beweisführung und die Erstellung des Schlussberichts. Für die Kontakte zu Staatsanwalt, Gericht und Verteidigung zuständig, überwachten sie oft auch die Besucher- und Anwaltsgespräche der Beschuldigten und führten Zelleninformatoren (ZI).
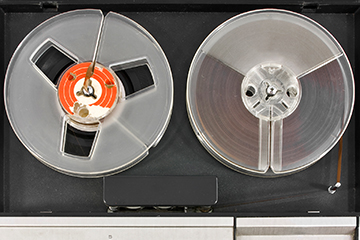
Schlusswort von Elli Barczatis im Geheimprozess gegen sie und Karl Laurenz wegen Spionage Audio, 9 Minuten, 12 Sekunden
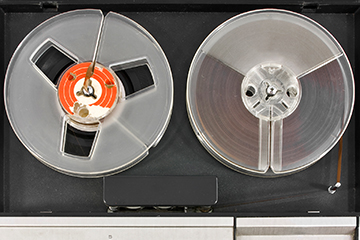
Vernehmung von Karl Laurenz im Geheimprozess gegen ihn und Elli Barczatis wegen Spionage Audio, 38 Minuten, 31 Sekunden
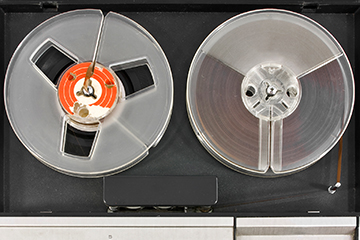
Vernehmung von Elli Barczatis im Geheimprozess gegen sie und Karl Laurenz wegen Spionage Audio, 1 Stunde, 11 Minuten, 50 Sekunden
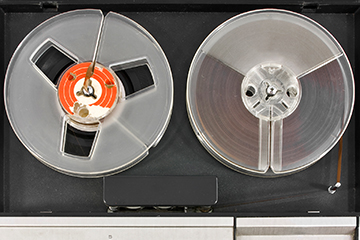
Eröffnung des Geheimprozesses gegen Elli Barczatis und Karl Laurenz wegen Spionage Audio, 4 Minuten, 7 Sekunden